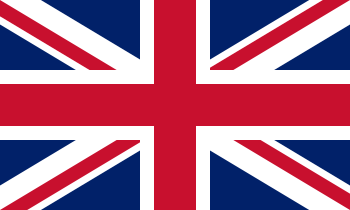Biber sind wahre Ökosystem-Ingenieure. Das haben wir schon oft gehört, doch was verbirgt sich hinter diesem sperrigen Begriff eigentlich? Ein Ökosystem-Ingenieur verändert seinen Lebensraum, das muss nicht immer zum Guten sein, im Fall des Bibers ist es das aber in der Tat.
Wie sich das äußert? Im Umkreis einer Biberburg halten sich bis zu achtzig Mal mehr Fische als im übrigen Bachverlauf auf. Dazu tragen u. a. die im Wasser liegenden umgenagten Baumstämme bei. Sie reichern durch Verwirbelungen das Wasser mit Sauerstoff an, dienen als Haftstruktur für den Fischlaich und werden von nahrhaften Algenrasen überwuchert. Auch an Land profitieren Kleinsäuger, seltene Vogelarten und Amphibien - wie Eisvogel oder Laubfrosch - sowie allerlei Insektenarten futter- wie unterschlupftechnisch von der Totholz-Oase.
Klingt soweit gut, bloß stößt sich der Mensch - obwohl er selbst ein Ökosystem-Ingenieur ist - ein wenig an dieser Fähigkeit des Bibers. Vielleicht mit ein Grund, warum die Tiere zur Mitte des 19. Jahrhundert bei uns ausgerottet wurden? - Damals hatte man es aber eher auf sein Fleisch und das vermeintlich aphrodisierend wirkende Biberfett abgesehen.
In den späten 1970er Jahren haben sich die Menschen aber wieder für den Biber erwärmt und einige der großen Nager in den Donauauen vor Wien wiederangesiedelt. Mit Erfolg. Mittlerweile haben sie sich sogar wieder im Thayatal blicken lassen. Die ersten Nagespuren im Nationalpark Thayatal ließen sich 2011 nachweisen. Und im April 2013 folgte der ultimative Nachweis via Foto, ein Biber wurde auf frischer Tat ertappt, an der Fugnitz in Hardegg. Wer mehr über die Rückkehr des Bibers ins Thayatal erfahren möchte, kann sich einfach in den Blogbeitrag vom Jänner 2014 reinklicken.
Vor allem abends und nachts stehen die Chancen gut, die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere zu erspähen. Die strikten Vegetarier halten es in erster Linie damit, in Gewässernähe nach Nahrung Ausschau zu halten. Nur ungern entfernen sie sich mehr als 20 Meter vom Wasser, sie schwimmen einfach viel besser als sie an Land watscheln. Und bevor sie einen Baum umnagen - eine Pappel von 70 Zentimeter Stammdurchmesser schaffen sie in einer Nacht - knabbern sie pragmatischerweise lieber das Grünzeug ab, das ihnen vor die Zähne kommt. Von der Kelle, dem unbehaarten Schwanz, bis zur Nasenspitze erreichen sie bis zu 135 Zentimeter. Mit dieser Größe lässt sich viel frisches Grün erwischen.
Dennoch scheinen sich die Menschen in ihrer eigenen Ökosystem-Ingenieurstätigkeit von den Bibern eingeschränkt zu fühlen. Ein häufiges Argument für Biber-Regulationen lautet, dass Biber unsere Sicherheit gefährden, sprich den Hochwasserschutz im wahrsten Sinne des Wortes untergraben.
Was es damit auf sich hat? - Nun, Biberfamilien bestehen in der Regel aus zwei bis vier Tieren und - je nach Nahrungsangebot - besiedeln sie zwischen 0,5 bis 5 Kilometer Uferlinie, manchmal auch bis zu 15 Kilometer. Die absoluten Biberzahlen entlang eines Gewässers halten sich damit also in Grenzen, aber es reicht mitunter die Emsigkeit einer einzigen Biberfamilie, um einen Hochwasserschutzdamm oder eine Uferböschung zu destabilisieren. Gleichzeitig sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Nager auch den gegenteiligen Effekt bewirken können. Durch das Abfressen von Weiden und Pappeln, die sich rasch verjüngen, tragen sie sogar zur Befestigung von Böschungen bei. Abhängig ist die Wirkung der Biber-Ingenieurstätigkeit stets von der jeweiligen Landschaftsstruktur, jedes Gewässer hat seine Spezifika, manche vertragen mehr Biber, andere weniger.
Mit ein Grund, warum das Land Niederösterreich 2015 eine Gesetzesänderung veranlasste. Biber - und übrigens auch Fischotter -, die bis dato im Jagdgesetz ganzjährig geschont waren, finden sich seit Neuestem im Naturschutzgesetz wieder. Der Unterschied? - Das Biber-Management lässt sich nun gezielter durchführen. Es geht nicht mehr darum, einzelne "Problembiber" zu entnehmen - wie etwa bisher - sondern im Fall "problematischer Populationen" - Lösungen für die ganze betroffene Region zu finden. Abschüsse sind - wie immer - das letzte Mittel der Wahl. Bevor es soweit kommt, bedienen sich die Biber-Verantwortlichen einer Reihe anderer Methoden, darunter bibersichere Gitter und Anstriche für Bäume, das Entfernen von Biberdämmen oder das Schließen von Biberröhren.
Sollte nichts helfen, sind Abschüsse nicht ausgeschlossen, allerdings machen sie aus verhaltensbiologischer Sicht wenig Sinn. Natürliche Feinde - à la Wolf, Luchs und Bär - haben nie einen entscheidenden Einfluss auf die Bestände der Biber genommen. Insofern muss der Mensch diese "Nische" erst gar nicht einnehmen.
Und außerdem erobern Biber nur solange neuen Lebensraum, wie er verfügbar ist. Machen sich geeignete Uferabschnitte rar, regulieren sie ihren Bestand selber, und zwar mittels innerartlicher Revierkämpfe. Natürlicherweise sinkt in solchen Gebieten zudem die Fortpflanzungsrate.
Einige Experten sehen es überhaupt so: Würde man den Biber nach seinen Vorstellungen walten lassen, ließe sich viel Geld für Renaturierungen sparen.
Im Thayatal - soviel steht fest - ist er auf jeden Fall willkommen!
Die Causa Biber ist aber sicher noch lange nicht ad acta gelegt, Fortsetzung folgt bestimmt ;-)
23.02.2016
Wie sich das äußert? Im Umkreis einer Biberburg halten sich bis zu achtzig Mal mehr Fische als im übrigen Bachverlauf auf. Dazu tragen u. a. die im Wasser liegenden umgenagten Baumstämme bei. Sie reichern durch Verwirbelungen das Wasser mit Sauerstoff an, dienen als Haftstruktur für den Fischlaich und werden von nahrhaften Algenrasen überwuchert. Auch an Land profitieren Kleinsäuger, seltene Vogelarten und Amphibien - wie Eisvogel oder Laubfrosch - sowie allerlei Insektenarten futter- wie unterschlupftechnisch von der Totholz-Oase.
Klingt soweit gut, bloß stößt sich der Mensch - obwohl er selbst ein Ökosystem-Ingenieur ist - ein wenig an dieser Fähigkeit des Bibers. Vielleicht mit ein Grund, warum die Tiere zur Mitte des 19. Jahrhundert bei uns ausgerottet wurden? - Damals hatte man es aber eher auf sein Fleisch und das vermeintlich aphrodisierend wirkende Biberfett abgesehen.
In den späten 1970er Jahren haben sich die Menschen aber wieder für den Biber erwärmt und einige der großen Nager in den Donauauen vor Wien wiederangesiedelt. Mit Erfolg. Mittlerweile haben sie sich sogar wieder im Thayatal blicken lassen. Die ersten Nagespuren im Nationalpark Thayatal ließen sich 2011 nachweisen. Und im April 2013 folgte der ultimative Nachweis via Foto, ein Biber wurde auf frischer Tat ertappt, an der Fugnitz in Hardegg. Wer mehr über die Rückkehr des Bibers ins Thayatal erfahren möchte, kann sich einfach in den Blogbeitrag vom Jänner 2014 reinklicken.
Vor allem abends und nachts stehen die Chancen gut, die dämmerungs- und nachtaktiven Tiere zu erspähen. Die strikten Vegetarier halten es in erster Linie damit, in Gewässernähe nach Nahrung Ausschau zu halten. Nur ungern entfernen sie sich mehr als 20 Meter vom Wasser, sie schwimmen einfach viel besser als sie an Land watscheln. Und bevor sie einen Baum umnagen - eine Pappel von 70 Zentimeter Stammdurchmesser schaffen sie in einer Nacht - knabbern sie pragmatischerweise lieber das Grünzeug ab, das ihnen vor die Zähne kommt. Von der Kelle, dem unbehaarten Schwanz, bis zur Nasenspitze erreichen sie bis zu 135 Zentimeter. Mit dieser Größe lässt sich viel frisches Grün erwischen.
Dennoch scheinen sich die Menschen in ihrer eigenen Ökosystem-Ingenieurstätigkeit von den Bibern eingeschränkt zu fühlen. Ein häufiges Argument für Biber-Regulationen lautet, dass Biber unsere Sicherheit gefährden, sprich den Hochwasserschutz im wahrsten Sinne des Wortes untergraben.
Was es damit auf sich hat? - Nun, Biberfamilien bestehen in der Regel aus zwei bis vier Tieren und - je nach Nahrungsangebot - besiedeln sie zwischen 0,5 bis 5 Kilometer Uferlinie, manchmal auch bis zu 15 Kilometer. Die absoluten Biberzahlen entlang eines Gewässers halten sich damit also in Grenzen, aber es reicht mitunter die Emsigkeit einer einzigen Biberfamilie, um einen Hochwasserschutzdamm oder eine Uferböschung zu destabilisieren. Gleichzeitig sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Nager auch den gegenteiligen Effekt bewirken können. Durch das Abfressen von Weiden und Pappeln, die sich rasch verjüngen, tragen sie sogar zur Befestigung von Böschungen bei. Abhängig ist die Wirkung der Biber-Ingenieurstätigkeit stets von der jeweiligen Landschaftsstruktur, jedes Gewässer hat seine Spezifika, manche vertragen mehr Biber, andere weniger.
Mit ein Grund, warum das Land Niederösterreich 2015 eine Gesetzesänderung veranlasste. Biber - und übrigens auch Fischotter -, die bis dato im Jagdgesetz ganzjährig geschont waren, finden sich seit Neuestem im Naturschutzgesetz wieder. Der Unterschied? - Das Biber-Management lässt sich nun gezielter durchführen. Es geht nicht mehr darum, einzelne "Problembiber" zu entnehmen - wie etwa bisher - sondern im Fall "problematischer Populationen" - Lösungen für die ganze betroffene Region zu finden. Abschüsse sind - wie immer - das letzte Mittel der Wahl. Bevor es soweit kommt, bedienen sich die Biber-Verantwortlichen einer Reihe anderer Methoden, darunter bibersichere Gitter und Anstriche für Bäume, das Entfernen von Biberdämmen oder das Schließen von Biberröhren.
Sollte nichts helfen, sind Abschüsse nicht ausgeschlossen, allerdings machen sie aus verhaltensbiologischer Sicht wenig Sinn. Natürliche Feinde - à la Wolf, Luchs und Bär - haben nie einen entscheidenden Einfluss auf die Bestände der Biber genommen. Insofern muss der Mensch diese "Nische" erst gar nicht einnehmen.
Und außerdem erobern Biber nur solange neuen Lebensraum, wie er verfügbar ist. Machen sich geeignete Uferabschnitte rar, regulieren sie ihren Bestand selber, und zwar mittels innerartlicher Revierkämpfe. Natürlicherweise sinkt in solchen Gebieten zudem die Fortpflanzungsrate.
Einige Experten sehen es überhaupt so: Würde man den Biber nach seinen Vorstellungen walten lassen, ließe sich viel Geld für Renaturierungen sparen.
Im Thayatal - soviel steht fest - ist er auf jeden Fall willkommen!
Die Causa Biber ist aber sicher noch lange nicht ad acta gelegt, Fortsetzung folgt bestimmt ;-)
23.02.2016