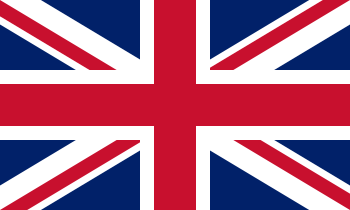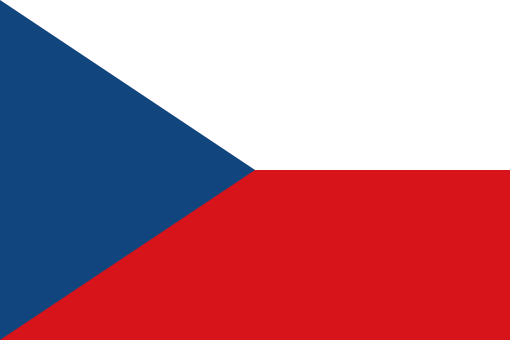Mit einem neuen Telemetrie-Projekt sollen nun Informationen über das Verhalten und die Raumnutzung der Wildkatze gesammelt werden.
Von einem Mehrfachnutzen für die Natur, die Region und das Wohlbefinden der Menschen sprach LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf am heutigen Mittwoch im Nationalparkhaus in Hardegg zum Start eines Wildkatzentelemetrie-Projekts. "Die 25 Jahre des 2000 gegründeten Nationalparks sind eine Erfolgsgeschichte für die Natur und eine Dableibensvorsorge für die Region. Die Natur wird erhalten, geschützt und weiterentwickelt, der sanfte Tourismus hat der Region einen nachhaltigen Aufschwung gebracht", betonte dabei Pernkopf.
So leben die Hälfte aller Vögel, Amphibien, Reptilien Österreichs sowie sieben von zehn Säugetierarten im grenzüberschreitenden Schutzgebiet, auch Seeadler und Wanderfalke seien wieder zurück gekommen, führte der LH-Stellvertreter aus und ergänzte: "Auf österreichischer Seite kommen zwischen 80.000 und 100.000 Besucher pro Jahr, 35.000 davon besuchen das Nationalparkhaus. Im Wildkatzencamp gab es im Vorjahr 5.000 Übernachtungen, für heuer gibt es schon 6.000 Voranmeldungen. Insgesamt sind die Nächtigungszahlen in Hardegg seit 2017 auf über 10.000 vervierfacht worden".
Nationalparkdirektor Christian Übl erläuterte das Wildkatzentelemetrie-Projekt: "2007 haben wir die als ausgestorben geltende Wildkatze bei uns im Nationalpark entdeckt, das war der Motor für die Wildkatzenforschung in ganz Österreich. Mittlerweile haben wir insgesamt 25 genetische und 23 Foto-Nachweise gesammelt. Neueste genetische Auswertungen zeigen nun, dass eine Wildkatze aus dem Thayatal auch eng mit den Wildkatzen in der Wachau verwandt ist, es besteht sogar eine Geschwister- oder Eltern-Kind-Beziehung. Daraus lässt sich schließen, dass diese über Wanderkorridore von der Wachau ins Thayatal gelangt ist. Dieser Nachweis ist insofern eine kleine Sensation, weil er ein Beweis dafür ist, dass die Wanderkorridore intakt sind und auch genutzt werden. In einer neuen Pilotstudie wird nun erstmals die Lebensraumnutzung und das Wanderverhalten der Tiere genauer untersucht".
Dazu wurden zwei Findlingskatzen vom Centre Athénas aus Frankreich nach einer genetischen Untersuchung in den Nationalpark gebracht, mit Sendern ausgestattet und - vorerst in einem Gehege - ausgewildert. Nach ca. einer Woche Beobachtung wird das Gehege geöffnet und die beiden Tiere werden in die Freiheit entlassen. Das Telemetrie-Halsband liefert exakte Informationen über den Aufenthaltsort der Wildkatzen. Die Forscher im Thayatal sind daran interessiert, wie das tageszeitliche und jahreszeitliche Verhalten der Tiere ist, bzw. welche Lebensräume sie bevorzugen und wie sich Störungen auf das Verhalten auswirken. Nicht zuletzt soll das Projekt Aufschluss darüber geben, ob die Tiere die Thaya überqueren, bislang fehlen nämlich die Nachweise aus dem benachbarten tschechischen Schutzgebiet Národní park Podyjí. Die Sender sind ein Jahr lang aktiv, das Halsband fällt mittels einer Sollbruchstelle nach Ablauf dieser Frist ab. In dieser Zeit sollen die Daten Aufschlüsse über den Bewegungsradius geben - bei weiblichen Tieren beträgt die Reviergröße im Durschnitt 300 bis 500 Hektar, bei männlichen 1.200 bis 2.000 Hektar. Da die Telemetrie-Erhebung erstmals in Österreich bei Wildkatzen stattfindet, wurde zunächst auf die zwei Findlingskatzen aus Frankreich zurück¬gegriffen. Nach Auswertung der gewonnen Erkenntnisse wird die Telemetrie-Erhebung in Zukunft vielleicht auch auf die Wildkatzen des Thayatales ausgedehnt.
Das Projekt wird durch das INTERREG CE Projekt Restore to Connect (ReCo) und vom Verein der Freunde des Nationalparks Thayatal gefördert und von dem Wildbiologen Andreas Kranz und dem Tierarzt Ingo Hofbauer begleitet.
Nähere Informationen beim Nationalpark Thayatal unter 02949/7005, e-mail office@np-thayatal.at und www.np-thayatal.at.
 Presseaussendung Wildkatzentelemetrie[DOCX, 97KB]
Presseaussendung Wildkatzentelemetrie[DOCX, 97KB]
02.04.2025
So leben die Hälfte aller Vögel, Amphibien, Reptilien Österreichs sowie sieben von zehn Säugetierarten im grenzüberschreitenden Schutzgebiet, auch Seeadler und Wanderfalke seien wieder zurück gekommen, führte der LH-Stellvertreter aus und ergänzte: "Auf österreichischer Seite kommen zwischen 80.000 und 100.000 Besucher pro Jahr, 35.000 davon besuchen das Nationalparkhaus. Im Wildkatzencamp gab es im Vorjahr 5.000 Übernachtungen, für heuer gibt es schon 6.000 Voranmeldungen. Insgesamt sind die Nächtigungszahlen in Hardegg seit 2017 auf über 10.000 vervierfacht worden".
Nationalparkdirektor Christian Übl erläuterte das Wildkatzentelemetrie-Projekt: "2007 haben wir die als ausgestorben geltende Wildkatze bei uns im Nationalpark entdeckt, das war der Motor für die Wildkatzenforschung in ganz Österreich. Mittlerweile haben wir insgesamt 25 genetische und 23 Foto-Nachweise gesammelt. Neueste genetische Auswertungen zeigen nun, dass eine Wildkatze aus dem Thayatal auch eng mit den Wildkatzen in der Wachau verwandt ist, es besteht sogar eine Geschwister- oder Eltern-Kind-Beziehung. Daraus lässt sich schließen, dass diese über Wanderkorridore von der Wachau ins Thayatal gelangt ist. Dieser Nachweis ist insofern eine kleine Sensation, weil er ein Beweis dafür ist, dass die Wanderkorridore intakt sind und auch genutzt werden. In einer neuen Pilotstudie wird nun erstmals die Lebensraumnutzung und das Wanderverhalten der Tiere genauer untersucht".
Dazu wurden zwei Findlingskatzen vom Centre Athénas aus Frankreich nach einer genetischen Untersuchung in den Nationalpark gebracht, mit Sendern ausgestattet und - vorerst in einem Gehege - ausgewildert. Nach ca. einer Woche Beobachtung wird das Gehege geöffnet und die beiden Tiere werden in die Freiheit entlassen. Das Telemetrie-Halsband liefert exakte Informationen über den Aufenthaltsort der Wildkatzen. Die Forscher im Thayatal sind daran interessiert, wie das tageszeitliche und jahreszeitliche Verhalten der Tiere ist, bzw. welche Lebensräume sie bevorzugen und wie sich Störungen auf das Verhalten auswirken. Nicht zuletzt soll das Projekt Aufschluss darüber geben, ob die Tiere die Thaya überqueren, bislang fehlen nämlich die Nachweise aus dem benachbarten tschechischen Schutzgebiet Národní park Podyjí. Die Sender sind ein Jahr lang aktiv, das Halsband fällt mittels einer Sollbruchstelle nach Ablauf dieser Frist ab. In dieser Zeit sollen die Daten Aufschlüsse über den Bewegungsradius geben - bei weiblichen Tieren beträgt die Reviergröße im Durschnitt 300 bis 500 Hektar, bei männlichen 1.200 bis 2.000 Hektar. Da die Telemetrie-Erhebung erstmals in Österreich bei Wildkatzen stattfindet, wurde zunächst auf die zwei Findlingskatzen aus Frankreich zurück¬gegriffen. Nach Auswertung der gewonnen Erkenntnisse wird die Telemetrie-Erhebung in Zukunft vielleicht auch auf die Wildkatzen des Thayatales ausgedehnt.
Das Projekt wird durch das INTERREG CE Projekt Restore to Connect (ReCo) und vom Verein der Freunde des Nationalparks Thayatal gefördert und von dem Wildbiologen Andreas Kranz und dem Tierarzt Ingo Hofbauer begleitet.
Nähere Informationen beim Nationalpark Thayatal unter 02949/7005, e-mail office@np-thayatal.at und www.np-thayatal.at.
02.04.2025